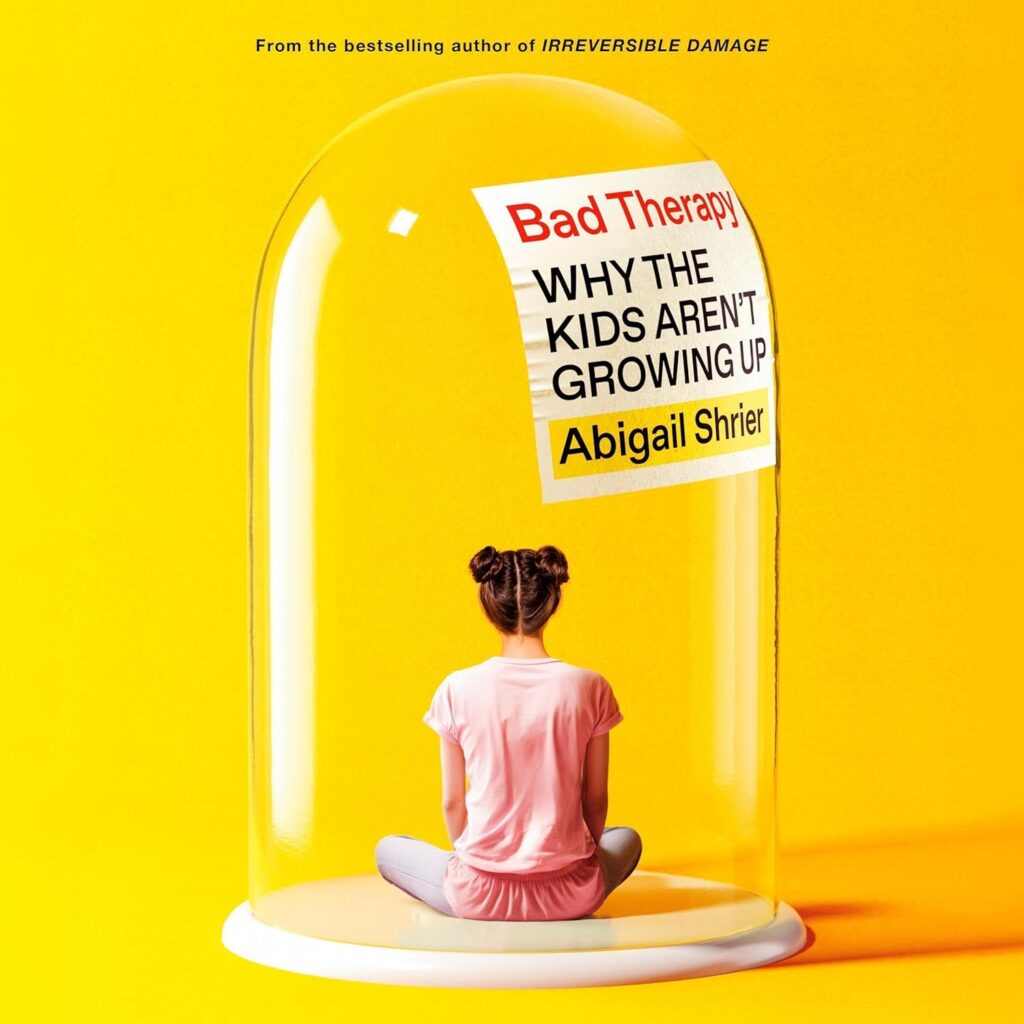Heute soll es mal nicht direkt um Beziehungsthemen gehen, sondern um ein Buch, welches ich sehr spannend fand. Habe euch mal die wesentloichen Punkte zusammengefasst. Wenn es euch mehr interessiert, dann schaut euch gerne das Buch an.
Einleitung
Abigail Shriers Buch „Bad Therapy: Why The Kids Aren’t Growing Up“ hat in der Fachwelt und darüber hinaus kontroverse Diskussionen ausgelöst. Mit scharfem Blick und journalistischem Feingefühl beleuchtet Shrier die Schattenseiten einer wachsenden therapeutischen Kultur, die – so ihre These – Kinder und Jugendliche zunehmend schwächt, anstatt sie zu stärken. Als erfahrener Psychologe möchte ich in diesem Artikel die Kernaussagen des Buches zusammenfassen, reflektieren und fachlich einordnen.
1. Die Grundthese des Buches
Shrier vertritt die provokante These, dass nicht die Kinder „kaputt“ seien – sondern dass viele psychotherapeutische Praktiken selbst für psychisches Ungleichgewicht und emotionale Labilität sorgen. Die übermäßige Pathologisierung normaler menschlicher Erfahrungen, ein inflationärer Gebrauch von Diagnosen, sowie eine Therapie-Industrie, die für jedes Problem eine klinische Intervention anbietet, führen laut Shrier zu einer systematischen Schwächung der Resilienz junger Menschen.
Psychologische Einordnung:
Die Kritik ist nicht neu – aber selten so klar formuliert. Der Trend zur Überdiagnostik (z. B. ADHS, Angststörungen, Depressionen) ist tatsächlich besorgniserregend, insbesondere wenn Diagnosen als Identität übernommen werden. Auch in meiner Praxis beobachte ich vermehrt junge Patient*innen, die sich mit Diagnosen identifizieren, statt sie als beschreibende, vorübergehende Zustände zu begreifen.
2. Therapie als Selbstzweck
Shrier argumentiert, dass regelmäßige Gesprächstherapie – besonders bei Kindern und Jugendlichen ohne schwerwiegende psychische Erkrankung – eher zum Grübeln, zur Retraumatisierung und zur Selbstfokussierung führen kann. Therapeutische Gespräche, die ständig um eigene Gefühle kreisen, fördern laut Shrier eine narzisstische Selbstzentriertheit und emotionale Dysregulation.
Psychologische Einordnung:
Es ist richtig, dass eine falsch verstandene oder falsch durchgeführte Gesprächstherapie negative Effekte haben kann. Therapie darf niemals ein Raum zur Selbstverklärung oder zur kultivierten Hilflosigkeit sein. Gute Therapie stärkt Autonomie, Selbstwirksamkeit und emotionale Integration – sie führt weg vom Symptom, nicht tiefer hinein.
3. Soziales-emotionales Lernen & Schulen als Therapiezentren
Ein weiterer Kritikpunkt: Schulen haben sich zu Nebenstellen der Therapiebranche entwickelt. Programme zum sozialen und emotionalen Lernen (SEL), ursprünglich gedacht zur Förderung von Empathie und Konfliktfähigkeit, werden laut Shrier oft missbraucht, um therapeutische Inhalte auf unreflektierte Weise in den Alltag zu integrieren – mit unerwünschten Nebenwirkungen.
Psychologische Einordnung:
Tatsächlich ist die schulische Einführung von SEL-Programmen eine zweischneidige Angelegenheit. Die Intention ist sinnvoll – doch die Umsetzung fehlt oft an Tiefgang, Fachpersonal und Langzeitperspektive. Therapie ersetzt keine Erziehung – und psychologische Bildung keine emotionale Reife. Gerade junge Menschen brauchen Klarheit, Grenzen und Vorbilder, nicht ständiges „Gefühlsmanagement“.
4. Sanfte Erziehung – ohne Halt
Shrier kritisiert zudem, dass die sogenannte „sanfte Erziehung“ Kindern oft keinen echten Rahmen mehr gibt. Eltern, die jede Emotion ihrer Kinder spiegeln, statt klar zu führen, überlassen Kinder einem emotionalen Chaos. Es sei, so Shrier, eine Form von Vernachlässigung unter dem Deckmantel der Achtsamkeit.
Psychologische Einordnung:
Diese Analyse ist erschreckend treffend. Kinder brauchen keine „besten Freunde“ als Eltern, sondern sichere, klare, präsente Bezugspersonen. Emotionale Begleitung ist wichtig – aber ohne Halt wird sie zur Überforderung. Führungsverantwortung in der Erziehung bedeutet nicht Härte, sondern Orientierung.
5. Die therapeutische Industrie als Teil des Problems
Abschließend skizziert Shrier ein System, in dem Therapeuten, Kliniken, Apps, Coaches und Programme ein Geschäftsmodell aus der Sorge um das seelische Wohl junger Menschen gemacht haben – und dabei teils mehr Schaden anrichten als Hilfe leisten.
Psychologische Einordnung:
Es braucht eine kritische Reflexion innerhalb unseres Berufsfeldes. Wenn Therapie zum Produkt wird, verliert sie ihre ethische Basis. Es darf nie darum gehen, Klienten dauerhaft an Therapie zu binden, sondern ihnen Werkzeuge zur Selbsthilfe zu geben. Der Berufsethos verlangt Demut, nicht Dogma.
Fazit
„Bad Therapy“ ist ein unbequemes, aber wichtiges Buch. Es stellt Fragen, die wir als Psychologen ernst nehmen müssen: Wo stärken wir wirklich – und wo schwächen wir? Wo begleiten wir sinnvoll – und wo bevormunden wir? Die Antwort liegt nicht im Verwerfen der Therapie, sondern im Besinnen auf ihre Wurzeln: Beziehung, Entwicklung und Menschlichkeit.